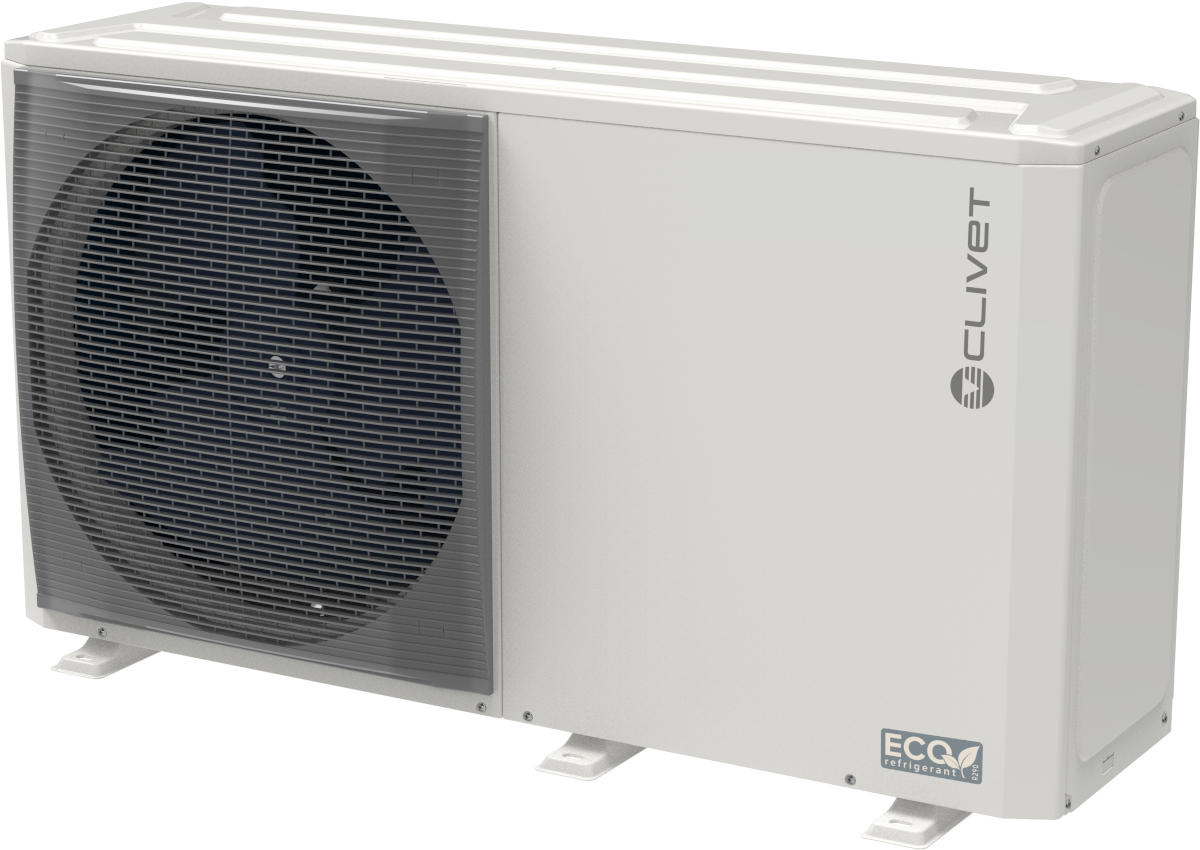Wärmepumpe und Fußbodenheizung
Die Wärmepumpe ist eine der zentralen Heiztechnologien der Energiewende. Je nach Heizlast des Gebäudes und den örtlichen Gegebenheiten kommen unterschiedliche Ausführungen infrage. In diesem Beitrag stellen wir die wichtigsten Arten von Wärmepumpen vor.
Luft-/Wasser-Wärmepumpe
Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe ist die am weitesten verbreitete Wärmepumpen-Art für Wohngebäude – sowohl im Neubau als auch bei der energetischen Sanierung. Ihr großer Vorteil liegt in der einfachen und kosteneffizienten Erschließung der Wärmequelle: der Umgebungsluft. Diese ist nahezu überall verfügbar, kostenlos und erfordert keine aufwändigen Bohrungen oder Brunnenanlagen. Damit bietet die Luftwärmepumpe einen besonders unkomplizierten Einstieg in die umweltfreundliche Heiztechnik.
Eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe funktioniert ähnlich wie ein umgekehrter Kühlschrank. Während der Kühlschrank Wärme aus dem Inneren nach außen abführt, entzieht die Wärmepumpe der Außenluft Wärme – selbst wenn es draußen kalt ist. Ein spezielles Kältemittel nimmt diese Energie auf, wird im Verdichter zusammengedrückt und dadurch stark erhitzt. Diese Wärme wird dann an das Heizungswasser im Haus abgegeben. Anschließend kühlt das Kältemittel wieder ab, und der Kreislauf startet von vorn.

Eine wichtige Kennzahl bei einer Wärmepumpe die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie gibt an, wie viel Wärmeenergie die Wärmepumpe im Jahresdurchschnitt aus einer Kilowattstunde Strom erzeugt, also ihr Verhältnis von abgegebener Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie.
Durch ihre Flexibilität, ihren vergleichsweise niedrigen Installationsaufwand und die kontinuierlich steigende Effizienz ist die Luft-/Wasser-Wärmepumpe zu einer der wichtigsten Technologien der Wärmewende geworden. Sie eignet sich sowohl für Bestandsgebäude – insbesondere nach energetischer Sanierung – als auch für Neubauten mit niedrigen Heizlasten. Darüber hinaus lässt sie sich sehr gut mit regenerativen Stromquellen wie Photovoltaikanlagen kombinieren, wodurch eine weitgehend autarke und emissionsarme Energieversorgung möglich wird.
📦 Varianten:
- Monoblock: Alle Komponenten in einem Gerät – oft außen aufgestellt, weniger Installationsaufwand
- Split-System: Innen- und Außeneinheit getrennt – erlaubt flexible Aufstellung und häufig leiseren Betrieb im Innenbereich
💰 Kostenübersicht:
- Anschaffung Wärmepumpe: ca. 8.000 – 15.000 €
- Installation & Zubehör: ca. 3.000 – 7.000 €
- Gesamtkosten: ca. 11.000 – 22.000 €, je nach Gebäudegröße, Dämmstandard und Systemausführung
📋 Planung & Voraussetzungen:
- Kein Zugang zu Erdreich oder Wasserquellen nötig – ideal bei beengten Platzverhältnissen
- Geringer Eingriff in die Bausubstanz
- Aufstellfläche für Außeneinheit notwendig, ggf. Schallschutzmaßnahmen beachten
- Kombination mit Niedertemperatursystemen (z. B. Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz
🔍 Vorteile:
- Vergleichsweise geringe Investitionskosten
- Einfache, schnelle Installation
- Hohe Flexibilität bei der Platzwahl
- Keine Genehmigungen für Wärmequellenerschließung nötig
- Gute Kombinierbarkeit mit Photovoltaik zur Eigenstromversorgung
- Lange Lebensdauer und wartungsarm
📌 Typische Einsatzbereiche:
- Neubauten mit energieeffizienter Bauweise
- Bestandsgebäude nach Sanierung
- Kombination mit Photovoltaikanlage für emissionsarmen Betrieb
- Ein- und Mehrfamilienhäuser, auch im städtischen Raum
⚠️ Zu beachten:
Beim Einsatz einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Die Effizienz des Systems nimmt bei sehr niedrigen Außentemperaturen ab, da weniger Wärme aus der Luft entzogen werden kann. In Regionen mit langen, kalten Wintern kann daher eine Zusatzheizung erforderlich sein, um den Wärmebedarf vollständig zu decken. Zudem erzeugt die Außeneinheit im Betrieb Geräusche, insbesondere durch die Ventilatoren und den Verdichter. Deshalb sollte bei der Planung auf ausreichenden Abstand zu Nachbargebäuden oder schallschutzsensiblem Wohnraum geachtet werden – gegebenenfalls sind Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Weiterhin ist eine gute Wärmedämmung des Gebäudes entscheidend, um die Heizlast niedrig zu halten und die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe zu optimieren. Je besser das Gebäude gedämmt ist, desto effizienter kann die Wärmepumpe arbeiten.
Die Brauchwasserwärmepumpe
Kompakte Lösung zur Warmwasserbereitung
Die Brauchwasserwärmepumpe ist speziell für die Erwärmung von Trink- bzw. Brauchwasser konzipiert. Sie nutzt die Umgebungsluft – etwa aus dem Keller, Hauswirtschaftsraum oder der Garage – als Wärmequelle, um das Wasser in einem integrierten oder angeschlossenen Speicher effizient zu erwärmen.
Vorteile:
- Sehr energieeffizient – besonders in Kombination mit Photovoltaik
- Ideal als Ergänzung zu bestehenden Heizsystemen
- Platzsparende Bauweise, einfache Installation
- Entfeuchtet gleichzeitig den Aufstellraum (z. B. Keller)
Kosten:
- Anschaffungskosten meist zwischen 2.000 € und 4.000 €
Zu beachten:
Die Temperatur der angesaugten Luft sollte ganzjährig ausreichend hoch sein. Bei sehr kalter Umgebungsluft sinkt die Effizienz spürbar. Zudem sollte das System regelmäßig gewartet werden, um eine hygienisch einwandfreie Warmwasserversorgung sicherzustellen.
Wasser-/Wasser-Wärmepumpe
Die Wasser-/Wasser-Wärmepumpe – auch als Grundwasserwärmepumpe bekannt – nutzt die im Grundwasser gespeicherte Wärme als Energiequelle. Über einen Förderbrunnen wird das Wasser an die Oberfläche befördert, dort thermisch genutzt und anschließend über einen Schluckbrunnen wieder in das Erdreich zurückgeführt. Theoretisch kann auch Oberflächenwasser aus Flüssen, Seen oder Teichen verwendet werden. In der Praxis wird aber fast ausschließlich Grundwasser genutzt, da die Nutzung von Oberflächenwasser meist nicht genehmigungsfähig ist.
💰 Kostenübersicht:
- Anschaffung Wärmepumpe: ca. 5.000 – 15.000 €
- Erschließungskosten: ca. 8.000 – 20.000 €, abhängig von Tiefe, Bodenverhältnissen und Wasserqualität.
- Grundwasser hat im Winter meist eine Temperatur von 8–12 °C – dadurch arbeitet die Wärmepumpe besonders effizient.
📋 Planung & Voraussetzungen:
- Zwei Brunnen erforderlich: ein Entnahmebrunnen (Förderbrunnen) und ein Rückgabebrunnen (Schluckbrunnen)
- Regionale Genehmigungspflicht für Bohrungen und Wasserentnahme
Wasserchemische Analyse nötig (Kalk, Eisen, Mangan etc. können Systeme belasten)
Ideal für Neubauten oder Modernisierungen mit langfristigem Planungshorizont
🔍 Vorteile:
- Sehr hoher Wirkungsgrad
Kaum Temperaturverluste über das Jahr hinweg
Besonders energieeffizient in Kombination mit Flächenheizungen (z. B. Fußbodenheizung)
⚠️ Zu beachten:
Nicht in allen Lagen umsetzbar – geologische, wasserrechtliche und technische Bedingungen müssen geprüft werden. Die Betriebssicherheit ist stark von der Wasserqualität und der korrekten Brunnenauslegung abhängig.
Sole-/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe)
Die Sole-/Wasser-Wärmepumpe nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs als Energiequelle. Sie entzieht über Erdkollektoren oder Erdsonden die gespeicherte Wärme aus dem Boden. Die dafür eingesetzte Sole – ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel – zirkuliert durch die unterirdisch verlegten Rohrsysteme, nimmt die Erdwärme auf und überträgt sie über einen geschlossenen Kreislauf an die Wärmepumpe. Diese hebt das Temperaturniveau an und speist die gewonnene Energie in das Heiz- oder Warmwassersystem des Gebäudes ein. Flachkollektoren benötigen viel Grundstücksfläche (ca. doppelte Wohnfläche), Erdsonden benötigen Tiefenbohrungen bis 100 m. Für Tiefenbohrungen sind meist wasserrechtliche oder bergrechtliche Genehmigungen erforderlich. Gerade in Regionen mit hartem Gestein oder Schiefer oder auch bei Gipsböden wegen des weichen Materials nicht flächendeckend möglich.
💰 Kostenübersicht:
- Anschaffung Wärmepumpe: ca. 12.000 – 20000 €
- Erschließungskosten: ca. 2.000 – 10.000 €, abhängig von Bodenbeschaffenheit, Tiefe und Aufwand
📋 Planung & Voraussetzungen:
- Erdsonden: vertikale Bohrungen (teilweise bis zu 100 m tief), platzsparender, aber aufwendiger in der Erschließung
- Grundstück muss über ausreichend Platz für Kollektoren oder über die Möglichkeit zur Tiefenbohrung für Sonden verfügen
- Genehmigungen können je nach Region erforderlich sein, insbesondere bei Tiefenbohrungen
Bodenverhältnisse beeinflussen Wärmeleitfähigkeit und damit die Effizienz der Anlage
🔍 Vorteile:
- Hohe Energieeffizienz durch konstante Erdtemperatur Geringe Betriebskosten Wartungsarm und langlebig
⚠️ Zu beachten:
Die Anfangsinvestitionen sind höher als bei Luftwärmepumpen. Dafür überzeugt das System mit zuverlässiger Leistung – auch bei Minusgraden – und besonders niedrigen Heizkosten über die Jahre.

Kombination von Fußbodenheizung und Wärmepumpe
Die Energiewende im Gebäudesektor ist längst eingeläutet. Dabei gilt die Kombination aus Wärmepumpe und Fußbodenheizung als Paradebeispiel für effizientes und klimafreundliches Heizen. Beide Systeme harmonieren technisch hervorragend miteinander und ermöglichen es, mit vergleichsweise geringem Energieeinsatz ein behagliches Wohnklima zu schaffen. Doch worauf kommt es an bei der Planung? Und lohnt sich die Investition am Ende wirklich?
Warum Wärmepumpe und Fußbodenheizung so gut zusammenpassen:
Wärmepumpen arbeiten besonders effizient, wenn sie möglichst niedrige Vorlauftemperaturen bereitstellen müssen. Optimal sind Vorlauftemperaturen von 30–35 °C. Bei sanierten Altbauten können auch 40–45 °C notwendig sein, was die Effizienz reduziert. Genau hier spielt die Fußbodenheizung ihre Stärken aus: Da sie großflächig in Bodenfläche integriert ist, kann sie auch mit diesen niedrigen Temperaturen für eine gleichmäßige und angenehme Wärmeverteilung im Raum sorgen. Radiatoren benötigen hingegen höhere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe deutlich mindert.
Ein weiterer Pluspunkt: Die Fußbodenheizung kann in Kombination mit reversiblen Wärmepumpen auch zur Kühlung genutzt werden. An heißen Tagen wird die Raumtemperatur durch Flächenkühlung abgesenkt. Im Kühlbetrieb muss auf die Taupunktunterschreitung geachtet werden, um Feuchtigkeit im Boden zu vermeiden. Hierbei sind unter Umständen Taupunktwächter erforderlich.
Energieeinsparung und Klimaschutz
Durch die niedrige Systemtemperatur und den Verzicht auf fossile Brennstoffe spart die Kombination nicht nur Energiekosten, sondern reduziert auch deutlich die CO2-Emissionen. Laut verschiedenen Studien können im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen bis zu 50 % Energie eingespart werden. In Neubauten ist dieses Zusammenspiel inzwischen Standard. Doch auch bei Sanierungen kann es eine lohnende Lösung sein, sofern der bauliche Rahmen passt.
Lohnt sich die Kombination auch im Altbau?
Ja, aber mit Einschränkungen. In Bestandsgebäuden ist es wichtig, zunächst die Dämmung und den allgemeinen energetischen Zustand zu prüfen. Nur wenn der Heizwärmebedarf ausreichend niedrig ist, kann die Wärmepumpe effizient arbeiten. Die Nachrüstung einer Fußbodenheizung ist baulich aufwendiger, besonders bei fehlendem Platz für Aufbauhöhen. Alternative Lösungen wie Trockenbausysteme, Dünnschichtsysteme oder Wandheizungen können hier Abhilfe schaffen.
Was ist zu beachten?
- Hydraulischer Abgleich: Damit die Fußbodenheizung gleichmäßig funktioniert, ist ein hydraulischer Abgleich zwingend erforderlich.
- Wärmebedarfsberechnung: Eine professionelle Auslegung stellt sicher, dass die Wärmepumpe richtig dimensioniert wird.
- Förderung nutzen: In Deutschland sind attraktive Förderprogramme verfügbar, z. B. über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
- Systemkompatibilität: Nicht jede Wärmepumpe eignet sich für jedes Gebäude. Eine fachkundige Beratung ist daher unerlässlich.
- Die Kombination Fußbodenheizung und Wärmepumpe erlaubt Jahresarbeitszahlen von >4, was sehr niedrige Heizkosten erlaubt. Das kann sogar Einfluss auf die Förderhöhe haben.
Fazit
Die Verbindung aus einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung ist eine zukunftssichere Lösung für energieeffizientes und komfortables Heizen und sogar Kühlen im Sommer. Sie eignet sich optimal für Neubauten, kann aber auch in sanierten Altbau sinnvoll eingesetzt werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Wer klimafreundlich und langfristig kostensparend heizen möchte, kommt an dieser Kombination kaum vorbei.